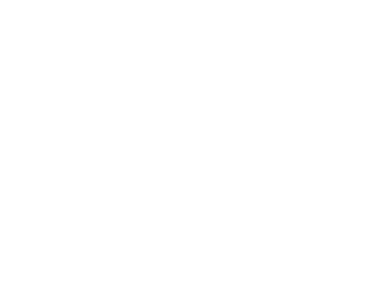Einzeln in Gemeinschaft
Dramaturg Torsten Buß im Proben-Gespräch mit Jürg Kienberger, Franziska Kuba und Philip Frischkorn, die die Produktion musikalisch entwickelt, geprobt und gestaltet haben.
Wie ging es euch, die ihr alle drei von der Musik kommt, beim Lesen von Elfriede Jelineks Text? Wie hat sie in euren Augen Müllers und Schuberts „Winterreise“ gespiegelt?
Franziska Kuba: Ich fand es sehr interessant, wie sie das geschafft hat, diesen Text von Wilhelm Müller in ihren eigenen Text zu integrieren, daraus Impulse zu nehmen, um Gedanken freien Lauf zu lassen. Das Musikalische passiert im Hintergrund, es ist eine große musikalische Affinität da. Manchmal sind die Zitate nur zu spüren.
Jürg Kienberger: Ich denke, Elfriede Jelinek hat sehr viel von der Stimmung in ihre Texte gebracht.
Philip Frischkorn: Ich finde es eine schöne Seite an Jelineks Text, dass die Bezüge manchmal ganz direkt auftauchen — und manchmal ist es tatsächlich eher so etwas wie die Verlorenheit, die auch in der „Winterreise“ zu spüren ist, die bei ihr in einem ganz anderen Kontext auftaucht. Ich habe heute Morgen einen sehr berührenden Beitrag über Demenz gehört und dabei an unser Stück gedacht. Natürlich erzählt Schuberts & Müllers Winterreise nichts direkt über Demenz, aber da gibt es Lieder, die — so wie vielleicht Jürg meint — genau diese Stimmung der Verlorenheit ausdrücken. Heute ist diese Verlorenheit vielleicht eine andere als in der Romantik, aber wir spüren, glaube ich, etwas sehr Ähnliches. Da spiegeln sich der Text und die Musik ineinander, und trotzdem entsteht in der Spiegelung etwas Neues, es ist nicht eins zu eins kopiert.
Franziska Kuba: Ich fand es sehr interessant, wie sie das geschafft hat, diesen Text von Wilhelm Müller in ihren eigenen Text zu integrieren, daraus Impulse zu nehmen, um Gedanken freien Lauf zu lassen. Das Musikalische passiert im Hintergrund, es ist eine große musikalische Affinität da. Manchmal sind die Zitate nur zu spüren.
Jürg Kienberger: Ich denke, Elfriede Jelinek hat sehr viel von der Stimmung in ihre Texte gebracht.
Philip Frischkorn: Ich finde es eine schöne Seite an Jelineks Text, dass die Bezüge manchmal ganz direkt auftauchen — und manchmal ist es tatsächlich eher so etwas wie die Verlorenheit, die auch in der „Winterreise“ zu spüren ist, die bei ihr in einem ganz anderen Kontext auftaucht. Ich habe heute Morgen einen sehr berührenden Beitrag über Demenz gehört und dabei an unser Stück gedacht. Natürlich erzählt Schuberts & Müllers Winterreise nichts direkt über Demenz, aber da gibt es Lieder, die — so wie vielleicht Jürg meint — genau diese Stimmung der Verlorenheit ausdrücken. Heute ist diese Verlorenheit vielleicht eine andere als in der Romantik, aber wir spüren, glaube ich, etwas sehr Ähnliches. Da spiegeln sich der Text und die Musik ineinander, und trotzdem entsteht in der Spiegelung etwas Neues, es ist nicht eins zu eins kopiert.
Ich finde, in ihrem Schreiben moduliert Elfriede Jelinek sich von einem Begriff ausgehend durch lauter Verschiebungen, bis sie irgendwann quasi in einer völlig anderen Tonart ist.
Philip Frischkorn: Das erinnert mich auch sehr an die Schubert’schen Modulationen. Sie sagt vieles nicht mit einem prägnanten Satz, sondern nimmt sich Zeit, etwas zu sagen in immer wieder anderen Facetten, immer wieder ein bisschen anders. So kenne ich das auch aus Schuberts Klaviersonaten, dass immer wieder dasselbe Thema auftaucht, aber jedes Mal in noch einer neuen Tonart …
Franziska Kuba: Zu Schuberts Zeit gab es eine feste Erwartungshaltung an Lieder. Es gab sogar eine Enzyklopädie, da konnte man nachlesen: A-Dur oder d-moll vermittelt folgendes Gefühl, man benutzt es in diesem oder jenem Kontext. Und wenn im Quintenzirkel nach oben oder unten moduliert wird, dann soll genau das und das ausgedrückt werden. Schubert hat in seinen Liedern aber vieles gemacht, was dem nicht entsprach. Er hat bekannte Stilmittel völlig anders benutzt, und anderes strukturiert er komplett neu — aber so, dass es unmittelbar etwas aussagt. Ich finde, Jelineks Assoziationsketten funktionieren ähnlich — sie wirken so zufällig, sie wirken sehr frei, und sind doch bewusst gesetzt.
Jürg Kienberger: Der Text kommt bei ihr so spielerisch daher, aber alles macht dann Sinn, wie sie es entwickelt.
Philip Frischkorn: Das erinnert mich auch sehr an die Schubert’schen Modulationen. Sie sagt vieles nicht mit einem prägnanten Satz, sondern nimmt sich Zeit, etwas zu sagen in immer wieder anderen Facetten, immer wieder ein bisschen anders. So kenne ich das auch aus Schuberts Klaviersonaten, dass immer wieder dasselbe Thema auftaucht, aber jedes Mal in noch einer neuen Tonart …
Franziska Kuba: Zu Schuberts Zeit gab es eine feste Erwartungshaltung an Lieder. Es gab sogar eine Enzyklopädie, da konnte man nachlesen: A-Dur oder d-moll vermittelt folgendes Gefühl, man benutzt es in diesem oder jenem Kontext. Und wenn im Quintenzirkel nach oben oder unten moduliert wird, dann soll genau das und das ausgedrückt werden. Schubert hat in seinen Liedern aber vieles gemacht, was dem nicht entsprach. Er hat bekannte Stilmittel völlig anders benutzt, und anderes strukturiert er komplett neu — aber so, dass es unmittelbar etwas aussagt. Ich finde, Jelineks Assoziationsketten funktionieren ähnlich — sie wirken so zufällig, sie wirken sehr frei, und sind doch bewusst gesetzt.
Jürg Kienberger: Der Text kommt bei ihr so spielerisch daher, aber alles macht dann Sinn, wie sie es entwickelt.
Wie ist es mit der Stimmbesetzungstradition der „Winterreise“? Heute gibt es den Klavierauszug für hohe, tiefe oder mittlere Stimmen …
Franziska Kuba: Zu Schuberts Zeit war die musikalische Kultur so, dass man Stücke halt in der Tonart spielte, in der sie gesungen werden sollten — oder konnten. Je nach Stimmlage wurde das einfach transponiert.
Franziska Kuba: Zu Schuberts Zeit war die musikalische Kultur so, dass man Stücke halt in der Tonart spielte, in der sie gesungen werden sollten — oder konnten. Je nach Stimmlage wurde das einfach transponiert.
Wie seid ihr vorgegangen für die musikalische Umsetzung in unserer Aufführung?
Franziska Kuba: Wir haben angefangen mit gemeinsamem Singen. Ich fand das bemerkenswert, dass sich daraus eigentlich erst herauskristallisiert hat, was wir genau machen wollen. Wir haben probiert: Wie klingt das eigentlich zusammen? Wie klingen wir zusammen?
Jürg Kienberger: Ja, die Chorarbeit war das Erste und bleibt eigentlich das musikalisch Wichtigste an dem Abend. Wir wollten wegkommen vom konzertanten Modus, nur mit Klavier und Solo-Stimme.
Franziska Kuba: Wir haben uns dann den vierstimmigen Satz angeguckt und geschaut, welchen Tonumfang es gibt im Spielensemble: Wie tief geht der Bass? Wie hoch geht der Tenor? Wie tief der Alt, wie hoch der Sopran? Und dann haben wir versucht, eine Tonart zu finden, in der alle Stimmen gut singen können.
Jürg Kienberger: Die letzte Stufe dieser Chorarbeit ist die Frage, wie die Chorpassagen auftauchen in der Inszenierung … Das hat viel mit Zartheit zu tun. Es muss präzis sein und doch so zart wie möglich. Alle Lieder können nicht vorkommen, und die Lieder müssen nicht immer mit ihrem ersten Takt beginnen. Sie müssen entstehen.
Philip Frischkorn: Ich habe noch mal den Probenprozess Revue passieren lassen, um den Moment zu greifen, an dem wir entschieden haben, dass das Klavier keine so große Rolle spielen soll für Schubert … Wir haben es ausprobiert, aber dann stand da immer jemand allein am Klavier, und jemand anderes musste singen. Das Tolle an der chorischen Lösung ist, dass dieses Verhältnis von solistischer Singstimme zu Begleitung, das man sonst immer bei Schubert hat, aufgelöst ist. Mich interessiert es mehr, wenn alle Stimmen gleichberechtigt von ihrer individuellen Einsamkeit singen, und daraus ein Gemeinschaftsgesang der Einsamkeit entsteht.
Jürg Kienberger: Im Schlusstext von Ellen kommt das ja vor: „Wir sind viele und doch jeder einzeln.“ In dieser Spannung entsteht die Geschichte — und entsteht auch unser Klang.
Philip Frischkorn: Wir haben oft den Gemeinschaftsklang, in dem die einzelne Stimme nicht so klar zu identifizieren ist — und dann gibt es die Momente, in denen jemand nach vorne kommt auf die Bühne, und auf einmal nehme ich ganz genau eine einzelne Stimme, eine einzelne Person wahr. Das finde ich ganz toll. Ich erlebe auf einmal, wie dieser Klang entsteht …
Jürg Kienberger: Das ist der Vorteil der Inszenierung im Vergleich zum Liederabend mit einem Sänger, einer Sängerin und einem Pianisten, einer Pianistin: Man hat bei uns jetzt noch neun andere Möglichkeiten mehr, eine Perspektive auf die „Winterreise“ zu bekommen.
Franziska Kuba: Wir haben angefangen mit gemeinsamem Singen. Ich fand das bemerkenswert, dass sich daraus eigentlich erst herauskristallisiert hat, was wir genau machen wollen. Wir haben probiert: Wie klingt das eigentlich zusammen? Wie klingen wir zusammen?
Jürg Kienberger: Ja, die Chorarbeit war das Erste und bleibt eigentlich das musikalisch Wichtigste an dem Abend. Wir wollten wegkommen vom konzertanten Modus, nur mit Klavier und Solo-Stimme.
Franziska Kuba: Wir haben uns dann den vierstimmigen Satz angeguckt und geschaut, welchen Tonumfang es gibt im Spielensemble: Wie tief geht der Bass? Wie hoch geht der Tenor? Wie tief der Alt, wie hoch der Sopran? Und dann haben wir versucht, eine Tonart zu finden, in der alle Stimmen gut singen können.
Jürg Kienberger: Die letzte Stufe dieser Chorarbeit ist die Frage, wie die Chorpassagen auftauchen in der Inszenierung … Das hat viel mit Zartheit zu tun. Es muss präzis sein und doch so zart wie möglich. Alle Lieder können nicht vorkommen, und die Lieder müssen nicht immer mit ihrem ersten Takt beginnen. Sie müssen entstehen.
Philip Frischkorn: Ich habe noch mal den Probenprozess Revue passieren lassen, um den Moment zu greifen, an dem wir entschieden haben, dass das Klavier keine so große Rolle spielen soll für Schubert … Wir haben es ausprobiert, aber dann stand da immer jemand allein am Klavier, und jemand anderes musste singen. Das Tolle an der chorischen Lösung ist, dass dieses Verhältnis von solistischer Singstimme zu Begleitung, das man sonst immer bei Schubert hat, aufgelöst ist. Mich interessiert es mehr, wenn alle Stimmen gleichberechtigt von ihrer individuellen Einsamkeit singen, und daraus ein Gemeinschaftsgesang der Einsamkeit entsteht.
Jürg Kienberger: Im Schlusstext von Ellen kommt das ja vor: „Wir sind viele und doch jeder einzeln.“ In dieser Spannung entsteht die Geschichte — und entsteht auch unser Klang.
Philip Frischkorn: Wir haben oft den Gemeinschaftsklang, in dem die einzelne Stimme nicht so klar zu identifizieren ist — und dann gibt es die Momente, in denen jemand nach vorne kommt auf die Bühne, und auf einmal nehme ich ganz genau eine einzelne Stimme, eine einzelne Person wahr. Das finde ich ganz toll. Ich erlebe auf einmal, wie dieser Klang entsteht …
Jürg Kienberger: Das ist der Vorteil der Inszenierung im Vergleich zum Liederabend mit einem Sänger, einer Sängerin und einem Pianisten, einer Pianistin: Man hat bei uns jetzt noch neun andere Möglichkeiten mehr, eine Perspektive auf die „Winterreise“ zu bekommen.