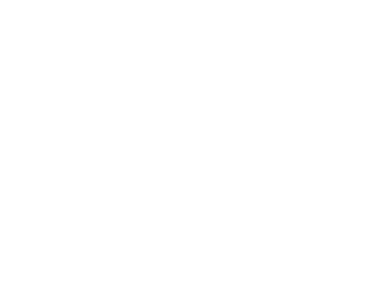Im Gespräch mit
Andreas Herrmann
Als Jugendlicher sang Andreas Herrmann im Dresdner Kreuzchor. Später studierte er Schauspiel an der Theaterhochschule „Hans Otto“ in Leipzig. In seiner 42-jährigen Laufbahn als Schauspieler arbeitete er unter anderem mit RegisseurInnen wie Frank Castorf, Manfred Karge, Konstanze Lauterbach und Thomas Bischoff zusammen. Nach sechs Jahren am Schauspiel Leipzig verabschiedet er sich am 30. April mit einer Lesung von „Die hellen Haufen“ in den unruhigen Ruhestand. Darüber hinaus befindet er sich momentan in den Endproben für seine letzte Produktion als festes Ensemblemitglied „Nacht ohne Sterne“.
Schauspiel Leipzig: Nach 42 Berufsjahren als Schauspieler probst du zurzeit deine letzte Produktion als festes Ensemblemitglied. Welche Figuren spielst du?
Andreas Herrmann: Ich spiele zwei Rollen. Die eine ist ein Patient, der an Krebs erkrankt ist und die Behandlung ablehnt, obwohl seine Tochter bereit wäre, Stammzellen zu spenden. Stattdessen geht er freiwillig in den Tod. Ich bin jetzt 65 und so langsam denke ich mir, irgendwann kann's einem selbst passieren und die Frage stellt sich dann vielleicht. Insofern ringt mir dieser Mensch eine große Achtung ab, weil er sich die Qual der ärztlichen Behandlung ersparen möchte. Die zweite Rolle ist eine Allegorie: die Freiheitsstatue. Ich betrachte sie als Fortsetzung dieser Vaterrolle im erlösten Zustand. Da gibt's einen schönen Satz, die Freiheitsstatue sagt zur Tochter: „Schwimmen, sich verlieben, Haltung zeigen: der Dreiklang des guten Lebens.“
SL: Was sind die Höhepunkte deines Schauspieler-Lebens?
AH: Da kann man entweder von Rollen sprechen oder von Begegnungen mit RegisseurInnen, die einen weitergebracht haben. Wenn ich von Rollen rede, fällt mir Don Juan ein, den habe ich 1992 in Magdeburg in den Freien Kammerspielen gespielt. Jahre später bin ich mal mit einem jungen Schauspieler ins Gespräch gekommen und der hat mir erzählt, dass er Schauspieler geworden ist, weil er in Magdeburg den Don Juan gesehen hat. (lacht) Weil du nach Erfolg fragst – es gibt eine Rolle, Mr. Peachum in Brechts Dreigroschenoper, den habe ich zum ersten Mal in Bremen gespielt. 1996 war die Premiere, letzte Vorstellung 2008. Anschließend war ich Peachum in Potsdam, in Aachen und bis vor drei Jahren in Leipzig. 20 Jahre dieselbe Rolle zu spielen, ist bei einem Schauspieler eher selten – bei SängerInnen kommt es öfter vor.
SL: Konntest du im Theater in den 42 Jahren eine bestimmte Veränderung beobachten?
AH: Ästhetisch hat sich unglaublich viel verändert, das ist ja auch vollkommen normal. Die ästhetischen Handschriften von RegisseurInnen spielen heute eine viel größere Rolle als noch vor 15 Jahren. Ich habe das Gefühl, dass es viel um Markenzeichen geht. Die Bildhaftigkeit oder die Stärke der Bilder kann sehr beeindruckend sein. Es kommt aber auch vor, dass ich als Zuschauer im Theater sitze und mir denke „Das ist ja toll. Aber was ist denn mit dem Inhalt?“. Auch das Aufblühen von SchauspielerInnen kann da unter Umständen ein bisschen verloren gehen. Das ist eine wesentliche Veränderung.
SL: Am 30. April verabschiedest du dich mit einer Lesung aus dem Ensemble des Schauspiel Leipzig. Du liest „Die hellen Haufen“ von Volker Braun. Warum dieser Text?
AH: Eine der intensivsten Zeiten meines Lebens war der Herbst ’89. Es ist heute schwer vorstellbar, welche Freude, welche Energie, in den Menschen war. Eine so grandiose Aufbruchsstimmung – das war die schönste Zeit. Dann hat sich Deutschland wieder vereinigt, und was danach kam, ich nenne es jetzt mal vorsichtig das „Umstrukturieren sämtlicher Lebensbereiche“, das beschreibt Volker Braun in „Die hellen Haufen“.
SL: Was ist deine Lieblingsstelle in der Bibel?
AH: Mein Lieblingssatz ist, weil ich den nie geschafft habe: „Sorget nicht für den morgigen Tag; denn der morgige Tag wird für das Seinige sorgen.“ Ich weiß gar nicht, wo das steht, aber aus der Kindheit hat sich das eingeprägt. So viel Selbstvertrauen oder sagen wir lieber Gottvertrauen zu haben, dass man sich dem Leben einfach anvertraut, das habe ich so nie gepackt.
SL: Und welche Rollen kommen noch?
AH: Das steht in den Sternen.
Andreas Herrmann: Ich spiele zwei Rollen. Die eine ist ein Patient, der an Krebs erkrankt ist und die Behandlung ablehnt, obwohl seine Tochter bereit wäre, Stammzellen zu spenden. Stattdessen geht er freiwillig in den Tod. Ich bin jetzt 65 und so langsam denke ich mir, irgendwann kann's einem selbst passieren und die Frage stellt sich dann vielleicht. Insofern ringt mir dieser Mensch eine große Achtung ab, weil er sich die Qual der ärztlichen Behandlung ersparen möchte. Die zweite Rolle ist eine Allegorie: die Freiheitsstatue. Ich betrachte sie als Fortsetzung dieser Vaterrolle im erlösten Zustand. Da gibt's einen schönen Satz, die Freiheitsstatue sagt zur Tochter: „Schwimmen, sich verlieben, Haltung zeigen: der Dreiklang des guten Lebens.“
SL: Was sind die Höhepunkte deines Schauspieler-Lebens?
AH: Da kann man entweder von Rollen sprechen oder von Begegnungen mit RegisseurInnen, die einen weitergebracht haben. Wenn ich von Rollen rede, fällt mir Don Juan ein, den habe ich 1992 in Magdeburg in den Freien Kammerspielen gespielt. Jahre später bin ich mal mit einem jungen Schauspieler ins Gespräch gekommen und der hat mir erzählt, dass er Schauspieler geworden ist, weil er in Magdeburg den Don Juan gesehen hat. (lacht) Weil du nach Erfolg fragst – es gibt eine Rolle, Mr. Peachum in Brechts Dreigroschenoper, den habe ich zum ersten Mal in Bremen gespielt. 1996 war die Premiere, letzte Vorstellung 2008. Anschließend war ich Peachum in Potsdam, in Aachen und bis vor drei Jahren in Leipzig. 20 Jahre dieselbe Rolle zu spielen, ist bei einem Schauspieler eher selten – bei SängerInnen kommt es öfter vor.
SL: Konntest du im Theater in den 42 Jahren eine bestimmte Veränderung beobachten?
AH: Ästhetisch hat sich unglaublich viel verändert, das ist ja auch vollkommen normal. Die ästhetischen Handschriften von RegisseurInnen spielen heute eine viel größere Rolle als noch vor 15 Jahren. Ich habe das Gefühl, dass es viel um Markenzeichen geht. Die Bildhaftigkeit oder die Stärke der Bilder kann sehr beeindruckend sein. Es kommt aber auch vor, dass ich als Zuschauer im Theater sitze und mir denke „Das ist ja toll. Aber was ist denn mit dem Inhalt?“. Auch das Aufblühen von SchauspielerInnen kann da unter Umständen ein bisschen verloren gehen. Das ist eine wesentliche Veränderung.
SL: Am 30. April verabschiedest du dich mit einer Lesung aus dem Ensemble des Schauspiel Leipzig. Du liest „Die hellen Haufen“ von Volker Braun. Warum dieser Text?
AH: Eine der intensivsten Zeiten meines Lebens war der Herbst ’89. Es ist heute schwer vorstellbar, welche Freude, welche Energie, in den Menschen war. Eine so grandiose Aufbruchsstimmung – das war die schönste Zeit. Dann hat sich Deutschland wieder vereinigt, und was danach kam, ich nenne es jetzt mal vorsichtig das „Umstrukturieren sämtlicher Lebensbereiche“, das beschreibt Volker Braun in „Die hellen Haufen“.
SL: Was ist deine Lieblingsstelle in der Bibel?
AH: Mein Lieblingssatz ist, weil ich den nie geschafft habe: „Sorget nicht für den morgigen Tag; denn der morgige Tag wird für das Seinige sorgen.“ Ich weiß gar nicht, wo das steht, aber aus der Kindheit hat sich das eingeprägt. So viel Selbstvertrauen oder sagen wir lieber Gottvertrauen zu haben, dass man sich dem Leben einfach anvertraut, das habe ich so nie gepackt.
SL: Und welche Rollen kommen noch?
AH: Das steht in den Sternen.