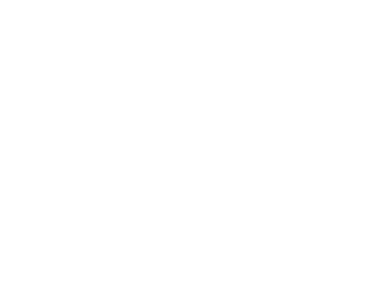Expertengespräche zur Spielzeit 2016/17 „Woher Wohin“
Aus den spielzeitbegleitenden Gesprächen der Saison „Woher Wohin“ in der Moderation von Dr. Jens Bisky dokumentieren wir im Folgenden einige der interessantesten Analysen und Impulse – sowie die kompletten Audio-Mitschnitte der Veranstaltungen.

Den Auftakt der Gesprächsreihe Woher Wohin machten am 30. Oktober 2016 Dr. Gregor Gysi (MdB) sowie Prof. Heinz Bude (Universität Kassel) zu der Frage: „Ist der Osten anders? Die Entwicklungen und Brüche in Ost- und Westdeutschland.“ Das Gespräch wurde in Auszügen auch auf MDR Kultur gesendet.
Heinz Bude:
„Den Osten“ gibt es nicht mehr. Genauso wenig, wie es„den Westen“ noch gibt. Ich glaube, der Osten wie der Westen muss sich darangewöhnen, dass wir heute mit neuen Situationen der Ungleichheit zu tun haben.Wir haben Regionen in Deutschland, die Vollbeschäftigung haben. Undgleichzeitig gibt es Städte in Ost wie in West, in denen sieht es ganz andersaus, da haben wir plötzlich eine neue Achse der Ungleichheit zwischen Parchimund Duisburg. Und das ist die Situation, die wir auch in der Zukunft habenwerden. Und gleichzeitig haben wir ein neues Proletariat in Deutschland. Dasist kein Proletariat der Industrie mehr, sondern ein Proletariat derDienstleistung: Leute, die in der Gebäudereinigung beschäftigt sind, imZustellwesen oder im Transportwesen. Und die verdienen überall, ob sie nun inParchim oder in München beschäftigt sind, bei harter Arbeit das gleiche wenigeGeld. Und in München können sie da noch viel weniger von leben und sterben alsin Parchim. Das ist eine neue Situation, in ganz Deutschland. Und deshalbglaube ich, dass die Debatte über den Osten und den Westen neu verhandeltwerden wird. Herr Gysi hat das auch im Blick auf das Auslaufen desSolidarpaktes II angesprochen: Diese Debatte sind wir gerade dabei einzuleiten,und es ist eine sehr wichtige Debatte für Deutschland, glaube ich.
Gregor Gysi:
Einen großen Unterschied zwischen Ost und West gibtes: Hier im Osten hat man 1989/90 einen sozialen Zusammenbruch erlebt. Ich warzur deutschen Einheit 42 Jahre alt. Stellen Sie sich vor, ich wäre arbeitslosgeworden und hätte bis zum Renteneintritt keinen Job mehr bekommen: Dann würdeich die Einheit völlig anders bewerten, als ich das jetzt tue. Es gab ja eineMassenarbeitslosigkeit. Und das erklärt aktuell übrigens einiges: Deshalb sinddie Ängste im Osten größer, dass so etwas auch noch einmal wieder passierenkann. Einen solchen sozialen Zusammensturz hat ja der Westen nie erlebt. Auchda gab es Krisen, aber einen solchen Zusammensturz nie. Das sind gänzlichunterschiedliche Erfahrungen, die eben auch zu unterschiedlichen Reaktionen führen.
„Den Osten“ gibt es nicht mehr. Genauso wenig, wie es„den Westen“ noch gibt. Ich glaube, der Osten wie der Westen muss sich darangewöhnen, dass wir heute mit neuen Situationen der Ungleichheit zu tun haben.Wir haben Regionen in Deutschland, die Vollbeschäftigung haben. Undgleichzeitig gibt es Städte in Ost wie in West, in denen sieht es ganz andersaus, da haben wir plötzlich eine neue Achse der Ungleichheit zwischen Parchimund Duisburg. Und das ist die Situation, die wir auch in der Zukunft habenwerden. Und gleichzeitig haben wir ein neues Proletariat in Deutschland. Dasist kein Proletariat der Industrie mehr, sondern ein Proletariat derDienstleistung: Leute, die in der Gebäudereinigung beschäftigt sind, imZustellwesen oder im Transportwesen. Und die verdienen überall, ob sie nun inParchim oder in München beschäftigt sind, bei harter Arbeit das gleiche wenigeGeld. Und in München können sie da noch viel weniger von leben und sterben alsin Parchim. Das ist eine neue Situation, in ganz Deutschland. Und deshalbglaube ich, dass die Debatte über den Osten und den Westen neu verhandeltwerden wird. Herr Gysi hat das auch im Blick auf das Auslaufen desSolidarpaktes II angesprochen: Diese Debatte sind wir gerade dabei einzuleiten,und es ist eine sehr wichtige Debatte für Deutschland, glaube ich.
Gregor Gysi:
Einen großen Unterschied zwischen Ost und West gibtes: Hier im Osten hat man 1989/90 einen sozialen Zusammenbruch erlebt. Ich warzur deutschen Einheit 42 Jahre alt. Stellen Sie sich vor, ich wäre arbeitslosgeworden und hätte bis zum Renteneintritt keinen Job mehr bekommen: Dann würdeich die Einheit völlig anders bewerten, als ich das jetzt tue. Es gab ja eineMassenarbeitslosigkeit. Und das erklärt aktuell übrigens einiges: Deshalb sinddie Ängste im Osten größer, dass so etwas auch noch einmal wieder passierenkann. Einen solchen sozialen Zusammensturz hat ja der Westen nie erlebt. Auchda gab es Krisen, aber einen solchen Zusammensturz nie. Das sind gänzlichunterschiedliche Erfahrungen, die eben auch zu unterschiedlichen Reaktionen führen.
30. Oktober 2016
Prof. Heinz Bude und Dr. Gregor Gysi
Prof. Heinz Bude und Dr. Gregor Gysi
Ist der Osten anders?
Die Entwicklungen und Brüche in Ost- und Westdeutschland — und der Umgang damit.
Das zweite Gespräch diskutierte am 20. November 2016 mit dem Politikwissenschaftler Prof. Hans Vorländer (TU Dresden) und dem Soziologe Dr. Oliver Nachtwey (TU Darmstadt) „Die Gesellschaft der Empörten.“
Hans Vorländer:
Nach der Globalisierungseuphorie haben wir jetzt das Gefühl, dass die Karten ganz neu gemischt werden. Wir wissen nur nicht, in welche Richtung. Wir müssen uns, glaube ich, wieder daran gewöhnen, dass wir diskutieren — und wir müssen streitiger diskutieren. Das muss aber auf einer gemeinsamen Grundlage stattfinden, die einerseits nicht die Demokratie in toto in Frage stellt und andererseits immer integrierend wirken sollte. Und wir brauchen ganz bestimmte Regeln, die zu verletzen wir ausschließen sollten.
Wir haben mittlerweile eine Wüste im sozialen, gesellschaftlich-institutionellen Bereich. Es gibt in vielen kleinen, wunderschön herausgeputzten Dörfern keine Kneipe mehr, wo man sich mit seinesgleichen treffen und beim Bier mal so richtig ablästern könnte. Man macht es jetzt in den sozialen Medien — und man macht es öffentlich auf der Straße. Dazu kommt als Moment die Enthemmungswirkung der sozialen Medien, dort haben sich sehr deutlich Filterblasen und Echokammern herausgebildet. Insofern gibt es keine öffentlich-gesellschaftliche Diskussion mehr im bisherigen Sinne, weil jeder sich seine Meinung im Netz suchen und bestätigen lassen kann. Jeder sucht sich seine Deuter im Netz und bleibt unter sich. Es gibt eine Parzellierung und eine Fragmentierung von dem, was man Öffentlichkeit nennt. Und wir reden alle aneinander vorbei.
Oliver Nachtwey:
Das Internet als Echokammer, das stimmt. Aber Facebook und das Internet sind zunächst einmal Medien, die gesellschaftliche Affekte reflektieren, und wir sollten nicht zu stark auf das Medium schauen, das fragmentiert, sondern auf die Gesellschaft. Und im Fehlen einer althergebrachten gesellschaftlichen Vielfalt, der Sozialisation durch Konflikte vor Ort, würde ich auch die richtige Spur sehen. Es gibt nicht mehr die Parteiversammlung, die Gewerkschaftsversammlung oder die Stammtische, wo man mal die eigene Wut artikulieren kann, aber dann auch die Widerrede bekommt. Und diese Widerrede, diese Form des demokratischen Diskurses vor Ort, die fehlt.
Aber eines der zentralen Probleme, die wir im politischen Diskurs haben, ist in meinen Augen, dass man auf Sachzwänge verweist, sei es die Globalisierung, sei es die Technologie, und dann den Leuten, die soziale Ängste haben, sagt: Na ja, da kann man nichts machen — gewöhnt euch dran, es gibt kein Zurück. Ich bin auch ein großer Freund der Individualisierung. Aber können wir nicht Individualisierung mit Sozialversicherung, mit vernünftiger Gesundheitsversicherung et cetera gestalten? Es gibt eine Gestaltbarkeit dieser Verhältnisse. Ich glaube, dass die Politik das könnte, oder die Gesellschaft.
Nach der Globalisierungseuphorie haben wir jetzt das Gefühl, dass die Karten ganz neu gemischt werden. Wir wissen nur nicht, in welche Richtung. Wir müssen uns, glaube ich, wieder daran gewöhnen, dass wir diskutieren — und wir müssen streitiger diskutieren. Das muss aber auf einer gemeinsamen Grundlage stattfinden, die einerseits nicht die Demokratie in toto in Frage stellt und andererseits immer integrierend wirken sollte. Und wir brauchen ganz bestimmte Regeln, die zu verletzen wir ausschließen sollten.
Wir haben mittlerweile eine Wüste im sozialen, gesellschaftlich-institutionellen Bereich. Es gibt in vielen kleinen, wunderschön herausgeputzten Dörfern keine Kneipe mehr, wo man sich mit seinesgleichen treffen und beim Bier mal so richtig ablästern könnte. Man macht es jetzt in den sozialen Medien — und man macht es öffentlich auf der Straße. Dazu kommt als Moment die Enthemmungswirkung der sozialen Medien, dort haben sich sehr deutlich Filterblasen und Echokammern herausgebildet. Insofern gibt es keine öffentlich-gesellschaftliche Diskussion mehr im bisherigen Sinne, weil jeder sich seine Meinung im Netz suchen und bestätigen lassen kann. Jeder sucht sich seine Deuter im Netz und bleibt unter sich. Es gibt eine Parzellierung und eine Fragmentierung von dem, was man Öffentlichkeit nennt. Und wir reden alle aneinander vorbei.
Oliver Nachtwey:
Das Internet als Echokammer, das stimmt. Aber Facebook und das Internet sind zunächst einmal Medien, die gesellschaftliche Affekte reflektieren, und wir sollten nicht zu stark auf das Medium schauen, das fragmentiert, sondern auf die Gesellschaft. Und im Fehlen einer althergebrachten gesellschaftlichen Vielfalt, der Sozialisation durch Konflikte vor Ort, würde ich auch die richtige Spur sehen. Es gibt nicht mehr die Parteiversammlung, die Gewerkschaftsversammlung oder die Stammtische, wo man mal die eigene Wut artikulieren kann, aber dann auch die Widerrede bekommt. Und diese Widerrede, diese Form des demokratischen Diskurses vor Ort, die fehlt.
Aber eines der zentralen Probleme, die wir im politischen Diskurs haben, ist in meinen Augen, dass man auf Sachzwänge verweist, sei es die Globalisierung, sei es die Technologie, und dann den Leuten, die soziale Ängste haben, sagt: Na ja, da kann man nichts machen — gewöhnt euch dran, es gibt kein Zurück. Ich bin auch ein großer Freund der Individualisierung. Aber können wir nicht Individualisierung mit Sozialversicherung, mit vernünftiger Gesundheitsversicherung et cetera gestalten? Es gibt eine Gestaltbarkeit dieser Verhältnisse. Ich glaube, dass die Politik das könnte, oder die Gesellschaft.
20. November 2016
Prof. Hans Vorländer und Dr. Oliver Nachtwey
Prof. Hans Vorländer und Dr. Oliver Nachtwey
Bröckelt die Verständigung?
Die Gesellschaft der Empörten.
Die Zukunft Europas aus französisch-polnisch-deutscher Perspektive besprach die Veranstaltung am 12. Februar 2017 mit dem deutsch-französischen Grünen-Politiker Daniel Cohn-Bendit sowie Róża Thun (Mitglied des Europäischen Parlaments für die polnische Platforma Obywatelska).
Róża Thun:
Ich finde, es gibt allein schon einen sehr großen Unterschied zwischen meiner Generation in Ost- und in Westeuropa: Für Leute meiner Generation im Westen ist der Zweite Weltkrieg schon sehr lange her, er ist Geschichte. Für meine Generation in Polen, für uns, die wir bis vor kurzem in unmittelbaren Folgen dieses Krieges gelebt haben, ist der Zweite Weltkrieg noch immer sehr nah. Für meine Generation ist das noch eine Realität, und für den Westen ist es eine komplette Abstraktion, dass überhaupt ein Krieg kommen kann, dass man unfrei leben kann, dass die Grenzen geschlossen werden. Es ist also unglaublich wichtig, immer wieder zu erklären, dass, wenn wir dieses gemeinsame Europa nicht hätten, unser Alltagsleben ganz anders wäre. Gerade auch mit Blick auf die Jahrzehnte des Friedens.
Daniel Cohn-Bendit:
Der Brexit kann Europa auseinandertreiben, aber der Brexit kann Europa auch stärken. Es kommt drauf an, was wir daraus machen. Es gibt keine deterministische Entwicklung hin zum Ende der EU. Ich glaube, dass die Europäer ganz gut wissen, wie gefährlich das wäre. Sehr wichtig wird sein, welche Regierung in Deutschland und in Frankreich sein wird. Denn bei der jetzigen Situation Europas wird es davon abhängen, wie Frankreich und Deutschland in der Lage sein werden, einen neuen europäischen Vorschlag zu machen. Und ich glaube, man wird dann aufhören mit einem Europa à la carte, in der Art von „ich will ein bisschen von dem und ich will ein bisschen hiervon, aber das schmeckt mir nicht; das esse ich vielleicht in fünf Jahren, aber das will ich jetzt nicht haben“. Das wird in Zukunft nicht mehr funktionieren meiner Meinung nach. Europa wird sich um den Euro strukturieren. Es wird vor der Frage stehen, wie man die demokratische Kontrolle verstärkt. Die Frage des sozial-ökonomischen Ungleichgewichts in Europa wird sicher ein Thema sein, ein gemeinsames Gebilde kann nicht mit so einer Ungerechtigkeit weiterleben. Und die Exekutivorgane werden politisch klarer definiert werden müssen. Ich glaube, das sind die Herausforderungen.
Und am Ende wird die Frage der politischen Einheit Europas immer dringender werden. Das ist die Debatte, die jetzt anfängt mit Trump und dadurch, dass sich zwangsläufig die Frage einer europäischen Verteidigung stellt, einer europäischen Sicherheit europäischer Grenzen. Die einen werden dann vielleicht wie die Engländer sagen: Wir wollen das nicht mehr. Aber grundsätzlich wird Europa stärker da rauskommen. In den nächsten fünf Jahren wird es perspektivisch eine europäische Renaissance geben.
Ich finde, es gibt allein schon einen sehr großen Unterschied zwischen meiner Generation in Ost- und in Westeuropa: Für Leute meiner Generation im Westen ist der Zweite Weltkrieg schon sehr lange her, er ist Geschichte. Für meine Generation in Polen, für uns, die wir bis vor kurzem in unmittelbaren Folgen dieses Krieges gelebt haben, ist der Zweite Weltkrieg noch immer sehr nah. Für meine Generation ist das noch eine Realität, und für den Westen ist es eine komplette Abstraktion, dass überhaupt ein Krieg kommen kann, dass man unfrei leben kann, dass die Grenzen geschlossen werden. Es ist also unglaublich wichtig, immer wieder zu erklären, dass, wenn wir dieses gemeinsame Europa nicht hätten, unser Alltagsleben ganz anders wäre. Gerade auch mit Blick auf die Jahrzehnte des Friedens.
Daniel Cohn-Bendit:
Der Brexit kann Europa auseinandertreiben, aber der Brexit kann Europa auch stärken. Es kommt drauf an, was wir daraus machen. Es gibt keine deterministische Entwicklung hin zum Ende der EU. Ich glaube, dass die Europäer ganz gut wissen, wie gefährlich das wäre. Sehr wichtig wird sein, welche Regierung in Deutschland und in Frankreich sein wird. Denn bei der jetzigen Situation Europas wird es davon abhängen, wie Frankreich und Deutschland in der Lage sein werden, einen neuen europäischen Vorschlag zu machen. Und ich glaube, man wird dann aufhören mit einem Europa à la carte, in der Art von „ich will ein bisschen von dem und ich will ein bisschen hiervon, aber das schmeckt mir nicht; das esse ich vielleicht in fünf Jahren, aber das will ich jetzt nicht haben“. Das wird in Zukunft nicht mehr funktionieren meiner Meinung nach. Europa wird sich um den Euro strukturieren. Es wird vor der Frage stehen, wie man die demokratische Kontrolle verstärkt. Die Frage des sozial-ökonomischen Ungleichgewichts in Europa wird sicher ein Thema sein, ein gemeinsames Gebilde kann nicht mit so einer Ungerechtigkeit weiterleben. Und die Exekutivorgane werden politisch klarer definiert werden müssen. Ich glaube, das sind die Herausforderungen.
Und am Ende wird die Frage der politischen Einheit Europas immer dringender werden. Das ist die Debatte, die jetzt anfängt mit Trump und dadurch, dass sich zwangsläufig die Frage einer europäischen Verteidigung stellt, einer europäischen Sicherheit europäischer Grenzen. Die einen werden dann vielleicht wie die Engländer sagen: Wir wollen das nicht mehr. Aber grundsätzlich wird Europa stärker da rauskommen. In den nächsten fünf Jahren wird es perspektivisch eine europäische Renaissance geben.
12. Februar 2017
Róża Thun und Daniel Cohn-Bendit
Róża Thun und Daniel Cohn-Bendit
Das Ende der Gemeinsamkeit?
Die Rückkehr des nationalen Gedankens in Europa.
Der vierte Termin der Gesprächsreihe diskutierte am 1. Juni 2016 die Frage der Rückkehr und der neuen Bedeutung der Religion(en). Dr. Johann Hinrich Claussen ist Theologe und Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche Deutschland, die 2017 das 500-jährige Jubiläum der Reformation begeht. Rena Tali ist 2015 aus dem Libanon nach Deutschland geflüchtet und Mitautorin des Bandes „95 Thesen auf die Zukunft“, in der sie die Vorrangstellung der Religion in den arabischen Staaten kritisiert. Diskutiert wurde auch die Bedeutung der Religion im Kreis der nach Deutschland Geflüchteten. Die Veranstaltung wurde gedolmetscht von Huda Alqaisi.
1. Juni 2017
Dr. Johann Hinrich Claussen und Rena Tali
Dr. Johann Hinrich Claussen und Rena Tali